Die Zeichen des Schmerzes lesen
12.10.18
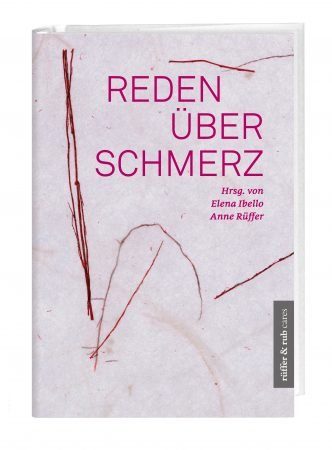
Lesen Sie hier exklusiv ein ganzes Kapitel über Onko-Plus-Pflegefachfrau Eveline Häberli aus dem Buch »Reden über Schmerz«, das eben erschienen ist! Die Anästhesie-Pflegefachfrau hat sich zur Schmerzspezialistin weiterbilden lassen.
Sabine Arnold
Eveline Häberli spricht mit Frau G. über Erdbeertörtchen. Die Palliativpflegefachfrau und ihre Patientin sitzen auf Frau G.s Terrasse. Der Zürichsee glänzt silbern in der Sonne, nur über dem Pfannenstiel hängen ein paar Wolken. Die 58-Jährige hat Eierstockkrebs, der bereits in andere Organe gestreut hat. Ihre Tage sind gezählt und dennoch strahlt sie eine grosse Lebendigkeit aus. Sie habe Appetit auf ungesunde Sachen, gesteht Frau G. verschämt, auf Spätzli, Pasta und eben Erdbeertörtchen. Dabei habe sie die letzten sieben Monate eine streng ayurvedische Diät eingehalten und tonnenweise Gemüse und Salat gegessen. »Was hält Sie davon ab, Ihren Gelüsten nachzugehen? Tun Sie das doch!«, ermuntert Eveline Häberli sie. Frau G. nickt und sagt, sie habe bereits damit begonnen, gestern habe ihr eine Freundin Penne gebracht.
Die beiden sprechen über Einläufe, Frau G. leidet an Verstopfung, und sie reden darüber, wo sie die letzten Tage ihres Lebens verbringen will. Eveline Häberli gibt ihr Prospekte über Hospize und rät zu einer Besichtigung. Für Frau G. ist klar, dass sie nicht zu Hause bleiben wird, bis sie stirbt. Ihr Partner sei beruflich zu eingespannt, arbeitet »150 Prozent«.
Schmerzen hat Frau G. keine, praktisch keine. Wenn sie nachts auf der Seite liege, spüre sie im Rumpf Knötchen, unterhalb der Rippen, sagt sie. Im Spital habe man ihr erläutert, dass es keine Metastasen seien sondern gestaute Lymphknoten.
»Oftmals treffe ich Krebspatientinnen und -patienten unterversorgt an.«
Für die meisten ihrer Patientinnen würden Schmerzen zu den Hauptsymptomen gehören, sagt Häberli auf der Rückfahrt in den Onko-Plus-Stützpunkt in Zürich-Oerlikon. »Aber nicht für alle.« Die Stiftung für mobile spezialisierte Palliativ- und Onkologiepflege betreut Menschen mit einer unheilbaren Krankheit zu Hause, 90 Prozent von ihnen haben Krebs, bei drei Vierteln verursachen Tumore und Metastasen Schmerzen. Wiederum die Hälfte davon leiden an mittel- bis sehr starken Schmerzen.
Oftmals treffe sie Krebspatientinnen und -patienten »unterversorgt« an, führt Häberli aus. Das heisst, sie haben bisher nicht genug Schmerzmittel erhalten. »Einige haben zwar Schmerzen, rufen im Spital aber deswegen nicht die Pflege. Pflegefachpersonen müssten die Kompetenz haben, Schmerzen zu erkennen, auch wenn Patientinnen und Patienten diese nicht explizit erwähnen, findet Eveline Häberli. Zu ihren Aufgaben gehörten das Beobachten, das Erkennen von Schonhaltungen und das Nachfragen. »Knie anziehen, kann Bauchweh heissen.«
Einige ihrer Patientinnen und Patienten würden ihren Körper wie Frau G. »scannen« und auf den kleinsten Schmerz, jedes unangenehme Gefühl achten. »Einige spüren das Wachsen des Tumors tatsächlich, andere stellen es sich nur vor«, sagt die Palliativpflegefachfrau, während sie den grossen Dienstwagen geschickt einparkt. Das sei doppelt belastend. Die sogenannte Raumforderung des wachsenden Krebsgewebes verursache häufig wirklich Schmerzen, zudem verstärke die Angst vor dem Tumorwachstum und vor dem nahenden Ende den Schmerz. Was tut sie dagegen? Sie nehme diese Ängste und Wahrnehmungen ernst, betont Häberli, sie gehe darauf ein, zeige Verständnis und beschönige nichts. Sie beruhigt die Patienten in solchen Situationen aber auch: »Das Gute ist, dass wir etwas haben, das den Schmerz bekämpft.«
Eveline Häberli ist eine lebensfrohe, bodenständige Person, die viel lacht. Gleichzeitig denkt sie viel über Themen wie Krankheit, Sterben und Tod nach, die sie in ihrem Job täglich beschäftigen. »Urvertrauen« ist ein Wort, das sie häufig verwendet. Das Schlimme für Tumorpatienten sei, dass sie ihrem Körper nicht mehr vertrauen könnten.
»Mit einem Hautschnitt eine Schmerzkaskade lostreten«
Die 38-jährige diplomierte Pflegefachfrau spezialisierte sich zunächst auf Anästhesie. Dieses Fach habe sie fasziniert, weil es viel Eigenverantwortung voraussetze, technisch sei und die Patientinnen und Patienten rasch wechselten. Gleichzeitig fehlte ihr dabei aber die Gesprächsführung als Herausforderung, deshalb kombinierte sie einen Pflegejob am Spitalbett mit einem in der Anästhesie. Später bildete sie sich zur Schmerzspezialistin weiter. Die Haltung der Chirurgen hatte sie alarmiert. Viele von ihnen seien am Thema Schmerz wenig interessiert, stellte Häberli fest, obwohl sie »mit einem Hautschnitt eine Schmerzkaskade lostreten«. Sie habe schon Oberärzte nach einer Operation zu Patientinnen sagen hören: »Das tut halt einfach weh.« Dieser Ansicht tritt sie vehement entgegen. Sie ist der Überzeugung, dass es enorm wichtig ist, akut eine gute Schmerztherapie anzubieten, um einer Chronifizierung entgegenzuwirken. Zu einem späteren Zeitpunkt könne man die starken Schmerzmittel problemlos wieder absetzen.
Gleichzeitig hält sie es bei Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen für zentral, dass der Fokus nicht allein auf der medikamentösen Therapie liege. Ganzheitlichkeit sei wichtig und dass die Betroffenen selber Strategien entwickeln, mit Schmerzen umzugehen.
Eveline Häberli weiss aus eigener Erfahrung, dass Schmerz einen zwingen kann, das Leben umzustellen. Aufgrund einer Fehlhaltung und der Abnützung durch ihren Lieblingssport Volleyball litt sie bereits als 30-Jährige in beiden Knien an Arthrose. Nach einer Odyssee von Arzt zu Arzt blieben schliesslich Krafttraining und eine experimentelle Eigenbluttherapie. Letztere musste sie selbst bezahlen, weil die Wirksamkeit nicht genügend nachgewiesen ist. Dabei zielt man darauf ab, dass die ins Knie gespritzten Blutzellen neuen Knorpel bilden.
»Ich musste lernen mit dem Schmerz zu leben, ohne auf Bewegung verzichten zu müssen. Das hat meine ganze Schmerzsituation enorm verbessert.«
Vor allem aber hörte sie damit auf, Volleyball zu spielen und suchte sich einen neuen Sport, der ihre Knie eher schont. Im Rollerderby fand sie ein Hobby, das ihrem Bewegungsdrang und ihrem Lebensstil entspricht. Bei diesem Vollkontaktsport, der aus den USA stammt und vor allem von Frauen ausgeübt wird, treten zwei Teams auf Rollschuhen in einer ovalen Rennbahn gegeneinander an. Häberli stellte fest, dass die gleitenden Bewegungen des Rollschuhlaufens ihren Knien viel besser taten als die Sprünge und abrupten Bewegungen beim Volleyball. Der Vollkontakt sei für ihre lädierten Knie natürlich dennoch nicht ideal, bemerkt sie bei einer Tasse Kaffee im Onko-Plus-Büro.
Ab und zu habe sie noch Schmerzen, manchmal beim Treppensteigen, tendenziell im Winter und gegen Abend. Ihr sei bewusst, dass jedes Kilogramm Körpergewicht weniger auch weniger Schmerzen bedeutet – und sie verfügt über ein Therapieprogramm, das sie selbstständig ausüben könnte, würden die Schmerzen wieder zunehmen. »Ich musste lernen mit dem Schmerz zu leben, ohne auf Bewegung verzichten zu müssen. Das hat meine ganze Schmerzsituation enorm verbessert.«
Eveline Häberli arbeitet zurzeit für Onko Plus und seit Kurzem für die Kispex, die Kinder-Spitex im Kanton Zürich. Mit chronischen Schmerzpatienten hat sie beruflich nicht mehr oft zu tun. Sie seien schwieriger zu behandeln gewesen als Palliativpatientinnen und -patienten, sagt sie. Bei unheilbar und schwer kranken Menschen wirkten potente Schmerzmittel oft gut und eine gezielte Gesprächsführung verbessere die Situation häufig bereits.
»Früher dachte man, Opioide sind nur für die, die bald sterben. Heute gibt es retardierte Formen, die weniger das Bewusstsein beeinträchtigen und weniger abhängig machen, weil sie kontinuierlich wirken.«
Dank ihrer Anästhesie-Ausbildung fühlt sich Häberli sicher im Umgang mit Opioiden. Sie kennt die Mythen, die sich um die starken Schmerzmittel ranken. Wie die meisten Fachpersonen in der Palliativmedizin fühlt sie sich verpflichtet, mit den Vorurteilen gegenüber Morphin & Co. aufzuräumen. »Früher dachte man, Opioide sind nur für die, die bald sterben. Heute gibt es retardierte Formen, die weniger das Bewusstsein beeinträchtigen und weniger abhängig machen, weil sie kontinuierlich wirken«, erklärt Häberli. Wie ihre Kollegin Monika Jaquenod-Linder, Konsiliarärztin von Onko Plus, entkräftet sie Vorurteil um Vorurteil gegenüber Opioiden und betont, dass sie von den Nebenwirkungen her viel weniger belastend seien als andere Schmerzmittel.
Nicht immer können Eveline Häberli und ihre Kolleginnen die enormen Schmerzen eindämmen, die Palliativpatientinnen und -patienten haben. Sie erinnert sich, in ihren fünf Jahren, die sie bereits für den Palliativpflegedienst arbeitet, an drei Menschen, deren Schmerz sie nicht kontrollieren konnten. Herr L. zum Beispiel war 45 Jahre alt, stammte aus Italien, lebte in guten Verhältnissen an der Goldküste und wusste, dass er seine Frau bald zurücklassen musste. »Dieser Patient schrie vor Schmerz, obwohl ich ihm Morphin spritzte, er schrie und schrie und schrie«, so Häberli. Furchtbar sei es gewesen, das aushalten zu müssen.
In der Palliativmedizin spricht man auch von »Total Pain«. Häberli beschreibt diesen als äusserst vielschichtigen Schmerz mit körperlichen, psychischen, sozialen und spirituellen Komponenten. Angst spiele dabei eine zentrale Rolle. Angst verstärkt den Schmerz, deshalb müsse man auch die Angst angehen, etwa mit Psychopharmaka oder Gesprächstherapien. Manche Menschen fürchteten zudem den Schmerz derart, dass sich dieser wie in einer selbsterfüllenden Prophezeiung um ein Vielfaches verstärke. Die Schmerzspezialistin sieht hier Parallelen zu den chronischen Schmerzpatientinnen und -patienten. Diese verfielen häufig aus Angst vor dem Schmerz in eine Passivität, wollten »aus Angst, etwas kaputt zu machen« Bewegungen vermeiden. Ein Teufelskreis, aus dem sie beinahe nicht mehr herausfinden.
Parallelen zwischen Geburt und Tod
Eveline Häberli wurde vor eineinhalb Jahren zum ersten Mal Mutter. Es war ihr Wunsch gewesen, möglichst natürlich – ohne Eingriffe – zu gebären, und sie wählte die Hausgeburt, unterstützt von einer Hebamme. Die junge Mutter beschönigt nichts. Die Wehen seien enorm schmerzhaft gewesen. Sie habe keine Vorwehen gehabt, dafür sei die Geburt schnell und intensiv verlaufen, fast ohne Pausen. Die Pressewehen, die Phase, in der das Kind aus dem Körper der Mutter gepresst wird, empfand sie als angenehmer, weil »es einfach mit mir gemacht hat«. Dennoch habe sie kurze Momente Angst um ihren Körper verspürt. »Es fühlte sich an, als würde er von innen gesprengt.« Gleichzeitig habe dieser Schmerz Sinn gemacht, und diese Sinnhaftigkeit habe geholfen, ihn auszuhalten. Ebenso hilfreich dafür sei das Wissen gewesen, wie der Schmerz anatomisch entsteht. »Er hatte seine Richtigkeit.«
Die Parallelen zwischen der Geburt und dem Tod werden in der Palliativmedizin häufig erwähnt. Sie sind nicht an den Haaren herbeigezogen, findet Eveline Häberli, die saugstarke Bettschutzauflagen in ihren Koffer räumt, weil sie noch einen Einsatz vor sich hat. Bei diesen Übergängen muss man darauf vertrauen, dass man den Schritt alleine bewältigen kann. Man kann die Verantwortung nicht abgeben.« Was man jedoch abgeben müsse, sei die Kontrolle. In beiden Fällen sei man auf eine Art ohnmächtig.
Häufig hätten Menschen, die ein Leben lang einflussreich gewesen seien, grosse Mühe, diese Ohnmacht während des Sterbens auszuhalten. »Viele wählen dann auch den Schritt des assistierten Suizids.«
»Bei Sterbenden hat die Schmerzbekämpfung einen hohen Stellenwert.«
Im modernen Mehrfamilienhaus, in dem Familie P. wohnt, muss Eveline Häberli Treppen steigen. Der Lift wird noch immer von den Rettungssanitätern blockiert. Sie haben Herrn P. vom Spital nach Hause gebracht – zum Sterben. Es sei sein ausdrücklicher Wunsch gewesen, unterstreicht seine Ehefrau, die die Pflegefachfrau an der Tür empfängt, und merkwürdig aufgekratzt wirkt. Sie bietet der Eintreffenden eine Cola an. Durch die Wohnung tollen zwei Hunde.
Herr P. ist 71 Jahre alt und leidet an einem Tumor, der seinen Magen einschränkt. In einem Regionalspital wurde versucht, die Verengung zu entfernen, um seine Lebensqualität zu verbessern. Nach der Operation lagerte sich jedoch viel Flüssigkeit im Bauchraum ab. Diese konnte nicht mehr abgesaugt werden, da es dem Patienten mittlerweile derart schlecht ging. Er äusserte wiederholt den Wunsch, nach Hause gehen zu dürfen.
Herr P. liegt bereits auf dem Pflegebett, das noch rechtzeitig bei der Krebsliga bestellt wurde. Nackt, ein Spitalleintuch über den Unterleib gebreitet. Seine Nase ist spitz, der Körper abgemagert, der Mund steht offen.
Dennoch sieht Herr P. entspannt aus, das sieht Eveline Häberli auf den ersten Blick. Sein lang ausgestreckter Körper, sein entspannter Gesichtsausdruck beweisen es ihr. Das Rettungsteam hat dem Patienten während der Fahrt intravenös Morphin gespritzt, um ihm den Transport zu erleichtern. Auf der Hälfte der Strecke hätten sie die Dosis senken können, weil er so ruhig war. Eveline Häberli installiert die mitgebrachte Schmerzpumpe. Durch dieses Gerät wird dem Patienten kontinuierlich eine Grunddosis an Schmerzmitteln verabreicht. Gleichzeitig können ihm seine Frau und seine Tochter, die ebenfalls vor Ort ist, per Knopfdruck einen zusätzlichen Bolus geben, wenn sie feststellen, dass er Schmerzen hat.
»Bei Sterbenden hat die Schmerzbekämpfung einen hohen Stellenwert«, sagt Häberli, während sie zusätzlich Spritzen mit Morphin und Haldol, einem Neuroleptikum, aufzieht. Letzteres wird etwa bei Halluzinationen oder starker Erregung eingesetzt, die in der Sterbephase auftreten können. Könnten Patientinnen und Patienten nicht mehr ausdrücken, dass sie Schmerzen haben, müsse das betreuende Team auf Körpersprache und -spannung, Bewegung und Mimik achten.
Es komme auch immer wieder vor, dass Patienten gegen das Lebensende hin wegen eines sogenannten Delirs verwirrt seien, also kognitiv beeinträchtig. Auch in diesen Fällen müssten die nonverbalen oder auch paraverbalen Zeichen wie Ächzen und Stöhnen wahrgenommen werden.
Angehörige leiden zwei-, Sterbenden nur einmal
Sterben selbst sei in den allermeisten Fällen wohl nicht schmerzhaft, fügt Häberli an, die nach dem Einsatz bei Familie P. nochmals zurück ins Büro fährt, um Verlaufsberichte zu schreiben. »Ausserdem leiden die Angehörigen häufig mehr, beziehungsweise zwei Mal statt nur ein Mal.« Ein erstes Mal im Chaos von Diagnose, Hoffnung auf Heilung, Verbesserung und Verschlimmerung des Gesundheitszustands, ein zweites Mal beim tatsächlichen Tod. Der Betroffene leide wohl im ersten Stadium mehr. Im eigentlichen Sterbeakt hingegen könne der Schmerz nachlassen. Viele zeigten sich ausserdem versöhnt mit ihrem Zustand. Es gehe ihnen gut, sagen sie, auch wenn sie nur noch liegen können. Ein weiteres Zeichen dafür, dass sie nicht in einem Todeskampf stecken, sieht Häberli in ihrer Uneigennützigkeit: »Sterbende sind altruistisch, sie denken nicht mehr an sich, sondern nur noch an die anderen. Sie sorgen sich um ihre Angehörigen, die sie zurücklassen.« Eine Patientin habe sich zum Beispiel Sorgen um ihren Mann gemacht, weil dieser nicht bügeln konnte.
Frau G. tritt nur zwei Tage nach Eveline Häberlis Besuch ins Spital ein, weil sie nonstop erbrechen muss. Bei ihr wird ein Darmverschluss diagnostiziert, der aufgrund ihres schlechten Allgemeinzustands nicht mehr operiert werden kann. Sie stirbt drei Wochen später im Hospiz St. Antonius in Hurden SZ am oberen Zürichsee.
Herr L. stirbt, während Eveline Häberli noch bei ihm ist. Seine Frau hat zwar die Ambulanz gerufen. Die Pflegefachfrau schickt die Rettungssanitäter aber wieder weg, weil der Sterbeprozess schon fortgeschritten ist. Der Mann wäre sonst auf der Fahrt gestorben.
Herr P. lebt noch zwei Tage. Er ist entspannt, schläft die meiste Zeit und stirbt dann ohne Schmerzen im Beisein seiner Familie. Seine Frau sagt später, sie bereue es, ihn nicht früher nach Hause geholt zu haben.
Dieser Text stammt aus dem Buch »Reden über Schmerz«, das im Verlag rüffer & rub erschienen ist. Es ist das dritte in der Reihe »rüffer & rub cares«, das in Zusammenarbeit mit der Fachorganisation palliative zh+sh entstanden ist. Es ist im Buchhandel (ISBN 978-3-906304-22-9) oder online erhältlich. Am Freitag, 12. Oktober 2018, wird im Zürcher Sphères, Hardturmstrasse 66, Vernissage gefeiert, unter anderen mit Eveline Häberli auf dem Podium. In einem anderen Kapitel im Buch kommt Monika Jaquenod-Linder, Konsiliarärztin von Onko Plus, zu Wort.